H₂-Hubs als Schlüssel für eine nachhaltige und effiziente Wasserstoffmobilität
Die Verkehrswende ist ein zentraler Baustein der deutschen Klimaschutzstrategie. Wasserstoff gilt dabei als entscheidender Energieträger, vor allem im Schwerlastverkehr. Doch wie können Wasserstofftankstellen (Hydrogen Refueling Stations – HRS) effizient, nachhaltig und wirtschaftlich mit Wasserstoff versorgt werden? Eine gemeinsame Studie der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) und der Deutschen Energie-Agentur (dena) untersucht vier Versorgungsoptionen über ein zukünftiges H₂-Pipelinenetz. H₂-Hubs als Verbindungselementen zwischen dem entstehenden H₂-Netz und den HRS kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Der Wasserstoffbedarf im Straßengüterverkehr in Deutschland wird bis 2045 auf bis zu zwei Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt. In diesem Szenario erfordert eine flächendeckende Versorgung die Errichtung von mehr als 2.000 H2-Tankstellen. Das geplante H₂-Kernnetz, das bis 2037 eine Gesamtlänge von 9.700 Kilometern erreichen soll, kann dabei eine zentrale Rolle spielen. Es besteht zu 60 Prozent aus umgenutzten Erdgasleitungen und soll Schritt für Schritt durch Verteilnetze ergänzt werden, um auch Regionen abseits der Haupttrassen zu erschließen. Das Netzwerk wird nicht nur Industrie und Kraftwerke, sondern auch andere Sektoren, wie z. B. den Mobilitätssektor, bedienen können, wodurch eine flexible und belastbare Wasserstoffinfrastruktur entsteht.
Die Rolle der H₂-Hubs
Ein zentrales Ergebnis der Studie: Eine ökonomisch attraktive und technisch machbare Versorgung der HRS über das H₂-Pipelinenetz ist möglich. Die techno-ökonomische Analyse der vier Versorgungsoptionen zeigt, dass ein H₂-Hub, der als zentrale Versorgungsstelle für eine Reihe von weiteren HRS fungiert und an das H₂-Kernnetz angeschlossen wird, die attraktivste Option darstellt.

HRS-Versorgung per Trailer von einem H₂-Hub, der an das H₂-Kernnetz angeschlossen ist. Dies ist die in der Studie präferierte Anbindungsoption an das H₂-Pipeline-Netz.
Die H₂-Hubs fungieren dabei als Bindeglieder zwischen dem H₂-Kernnetz und den regionalen Tankstellen und sind über eine Stichleitung direkt verbunden. Sie übernehmen zentrale Prozesse wie die Aufreinigung, Komprimierung und Speicherung des Wasserstoffs. Dadurch werden Skaleneffekte erzielt, die nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch die technischen Anforderungen an den Betrieb der Tankstellen reduzieren. Der Wasserstoff wird anschließend per Trailer in unterschiedlichen Druckstufen an die umliegenden Tankstellen verteilt – die Studie unterstellt einen Radius von 50 Kilometern. Je nach Auslastung ist auch die Belieferung von Kunden denkbar, die nicht aus dem Mobilitätssektor kommen, aber ähnliche Anforderungen an die Wasserstoff-Qualität stellen.
H₂-Hubs bieten zudem Flexibilität bei der Einbindung unterschiedlicher Wasserstoffquellen. So können sie über Pipelines aus dem Kernnetz (Gegenstand der Studie), durch lokale Elektrolyse oder mittels anderer Transportmittel wie Zügen und Schiffen versorgt werden (dies wurde in der Studie nicht untersucht). Das macht sie zu einem Schlüsselbaustein für die effiziente und nachhaltige Wasserstoffmobilität in Deutschland.

Spezifische Transport- und Aufbereitungskosten für H₂-Versorgung per Trailer von einem H₂-Hub mit Anschluss an das H₂-Kernnetz: Kostenbestandteile in zwei unterschiedlichen Szenarien der präferierten Anbindungsoption für 2030.
Technische und regulatorische Herausforderungen
Die Sicherstellung der Wasserstoffqualität für den Einsatz in Brennstoffzellenfahrzeugen ist eine der entscheidenden Herausforderungen, vor denen die H₂-Hubs stehen. Der aus der Pipeline bezogene Wasserstoff muss entsprechend den Reinheitsanforderungen der DIN EN 17124 aufbereitet werden, was zusätzliche Investitionen in innovative Technologien erfordert. Ebenso wichtig ist die zeitnahe Festlegung von Netzentgelten und Netzanschlussgebühren, um Planungssicherheit für Investoren zu schaffen.
Transportdistanzen stellen einen wesentlichen Kostentreiber dar. Die Positionierung der H₂-Hubs in der Nähe von Regionen mit hohem Wasserstoffbedarf und hoher Tankstellendichte ist daher entscheidend. Gleichzeitig müssen regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine reibungslose Integration der H₂-Hubs in die bestehende Infrastruktur ermöglichen.
Handlungsempfehlungen für den Aufbau
Die Studie formuliert neun konkrete Handlungsempfehlungen, um eine effiziente Versorgung von Wasserstofftankstellen über ein H₂-Pipelinenetz zu schaffen:
- Integration der Planungen: H₂-Netze und Tankstelleninfrastruktur müssen in der Entwicklung eng verzahnt werden, um Synergien zu nutzen.
- Bedarfserfassung: Der Aufbau einer zentralen Plattform zur Erfassung des Wasserstoffbedarfs erleichtert die Planung und Identifikation geeigneter H₂-Hub-Standorte.
- Standortkriterien: Die Entwicklung transparenter Kriterien für die Standortwahl von H₂-Hubs fördert eine zielgerichtete Planung.
- Ermittlung von möglichen H₂-Hub-Betreibermodellen, in die auch lokale Akteure aktiv eingebunden werden sollten, um regionale Wertschöpfungsketten zu stärken.
- Pilotierung: Ein erster H₂-Hub sollte bis 2030 pilotiert werden, um praktische Erfahrungen zu sammeln und Optimierungspotenziale zu identifizieren.
- Weitere Untersuchung des Schlüsselaspekts „Wasserstoffqualität“: Wie und zu welchen Kosten kann die Aufreinigung des aus der Pipeline entnommenen Wasserstoffs gewährleistet werden (bei schwankender Qualität / unterschiedlichen Verunreinigungen)?
- Technologieentwicklung: Weiterentwicklungen in der Wasserstoffaufbereitung und -verdichtung sind essenziell, um Skaleneffekte zu erzielen.
- Netzentgelte: Frühzeitige Festlegungen von Netzentgelten und Anschlussgebühren schaffen Investitionssicherheit.
- Ganzheitliche Analysen: Die Untersuchung der Auswirkungen der Pipeline-Versorgung über das H2-Netz sollte auch auf andere Bereiche (ökologisch, sozial etc.) ausgeweitet werden.
Fazit
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Wasserstofftankstellen in Zukunft effizient, nachhaltig und wirtschaftlich über ein H₂-Pipelinenetz mit Wasserstoff versorgt werden können. H₂-Hubs kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen könnten sie zu einem Schlüsselbaustein einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur werden.
Langfristig ist das Ziel, eine flächendeckende Wasserstoffversorgung zu gewährleisten, die nicht nur den Verkehrssektor, sondern alle Anwendungen integriert. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit solch einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur zu gewährleisten. H₂-Hubs bieten hierbei eine flexible und skalierbare Lösung, die es erlaubt, die Infrastruktur schrittweise an den steigenden Bedarf anzupassen.
Literatur:
NOW GmbH & dena: „Versorgung der H₂-Tankstelleninfrastruktur in Deutschland über ein H₂-Pipeline-Netz“, 2024.



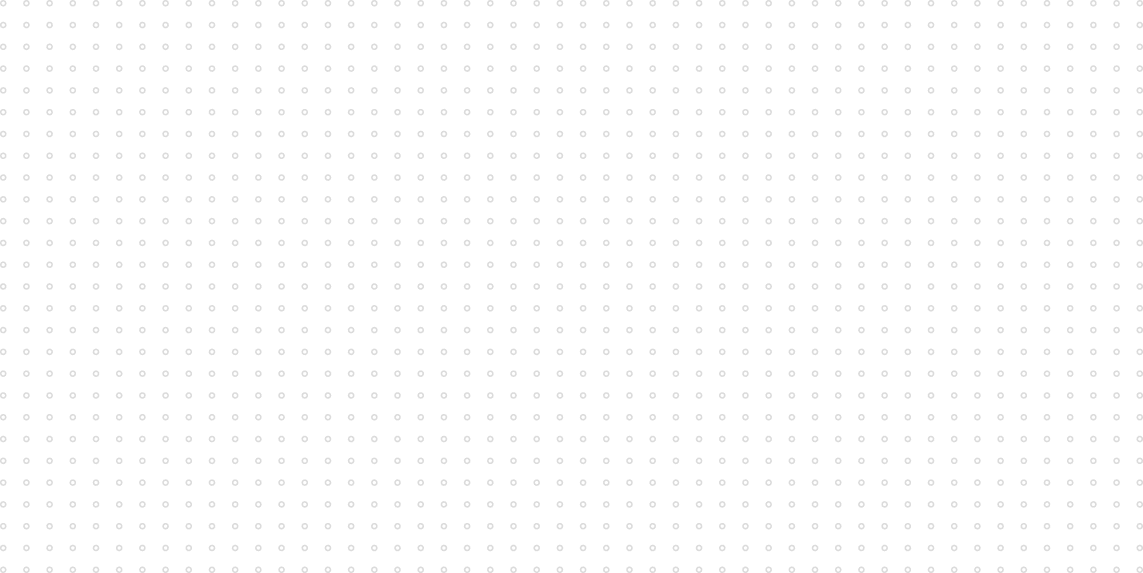



0 Kommentare