Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Hydrogen + Fuel Cells Europe
Die Stimmung war gut. Nicht euphorisch, wie teilweise noch im vergangenen Jahr, aber durchaus lebhaft. Insbesondere in Halle 13, wo die Hydrogen + Fuel Cells Europe stattfand, waren die Gänge gut gefüllt und das Stimmengewirr deutlich lauter als in den anderen Hallen auf dem Messegelände. Dennoch bleibt der Eindruck, dass auch im 30. Jahr dieser H2-Messe der Marktdurchbruch immer noch auf sich warten lässt und erst „in fünf Jahren“ erfolgt, so wie es schon seit 20 Jahren zu hören ist.
Die Hannover Messe nimmt immer noch für sich in Anspruch, die weltweit bedeutendste Industriemesse zu sein – laut Dr. Jochen Köckler, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Deutschen Messe AG, ist sie sogar „die Mutter aller Messen“. Wie schon in den vergangenen Jahren profitierte sie auch vom 22. bis 26. April 2024 immens vom derzeitigen H2-Boom. Das große Interesse an Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie führte mal wieder zu akzeptablen Aussteller- und Besucherzahlen. Neue Impulse als Hinweis, in welche Richtung sich das klassische Messegeschäft entwickeln könnte, gab es jedoch nicht.
Man kann sagen, die H2-Messe hat der Deutschen Messe mal wieder die Bilanz gerettet.
Kanzler Scholz besucht H2-Unternehmen
Nicht ohne Grund stattete auch Bundeskanzler Olaf Scholz der Hydrogen + Fuel Cells Europe einen Besuch ab. Der Schwerpunkt seines Eröffnungsrundgangs lag in den Energie-Hallen, wo er neben Salzgitter („Wir begeben uns gemeinsam auf die Reise.“ – s. Abb. 2) auch bei GP Joule Station machte. Ove Petersen, Mitgründer und einer der Geschäftsführer von GP Joule, betonte dabei, wie wichtig die Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen sei, damit es tatsächlich zu einem Aufbau der Elektrolyseurkapazitäten kommen könne (s. dazu auch S. 18).
Abb. 2: Kanzler O. Scholz mit dem norwegischen Ministerpräsidenten J. G. Støre, Salzgitter-Chef G. Groebler, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten S. Weil, der norwegischen Wirtschaftsministerin C. Myrseth, Bundesfamilienministerin L. Paus sowie Bundesforschungsministerin B. Stark-Watzinger
Aufschlussreiche Wortwahl
Interessant zu beobachten war, wie sich die Wortwahl auf manchen Gebieten verändert: So war in zahlreichen Vorträgen immer wieder die Rede von „Low-Carbon-Wasserstoff“. Mit dieser Wortschöpfung umgehen die Redner geschickt die Einordnung des Wasserstoffs in die mittlerweile bei einigen recht unbeliebt gewordene Farbskala. „Low-Carbon“ impliziert, dass während der H2-Herstellung wenig Kohlenstoffdioxid emittiert wurde, vermeidet aber eine Stigmatisierung durch die Attribute „grau“, „blau“ oder „türkis“, denn selbst kleinste Beimischungen von grünem Wasserstoff reichen aus, um ihn als kohlenstoffarm bezeichnen zu können.
Grün oder blau
Für Olaf Lies, den niedersächsischen Wirtschaftsminister, ist blauer Wasserstoff „ein Riesenthema zur Erreichung der Klimaziele“. Angesichts der leidigen Farbendiskussion gab er in Hannover zu bedenken, dass bei Strom keiner nach der Farbe frage. „Das muss bei Wasserstoff auch so kommen“, so der Minister.
Eine weitere Neuerung im Sprachstil scheint das Arbeitsprinzip in der Wasserstoffwirtschaft zu betreffen: So sind immer wieder Sätze wie „Partnership is the new leadership“ (Partnerschaft ist die neue Führerschaft) oder „Cooperation is key“ (Kooperation ist der Schlüssel) zu hören. Bei immer mehr Akteuren macht sich also die Erkenntnis breit, dass der derzeit stattfindende Transformationsprozess in der Energiebranche nicht allein, sondern nur gemeinsam gemeistert werden kann.
Gleich geblieben ist hingegen der Zeithorizont bis zum Markthochlauf. Hier liegen wir nach wie vor bei fünf Jahren. Während es in den vergangenen Jahren noch hieß, H2-Lkw würden ab 2025 in Serie gebaut, brachten Vertreter*innen der Fahrzeugindustrie sehr deutlich zum Ausdruck, dass hierzulande mit nennenswerten Stückzahlen frühestens 2029 zu rechnen sei. Anders sieht es in Asien aus: Refire warb beispielsweise damit, bereits heute 5.000 Brennstoffzellensysteme pro Jahr bauen zu können.
Immerhin bekannte sich Dr. Matthias Jurytko, CEO von Cellcentric, sowohl zur H2-Technik als auch zum Standort Deutschland, indem er sagte: „Viele reden von Fabriken – wie bauen eine.“ Weiter stellte er klar: „Wasserstoff wird der Treiber sein für den Langstreckenverkehr.“ Gleichzeitig räumte er jedoch ein: „Ein Anstieg der Stückzahlen wird erst 2029/30 kommen.“
Abb. 3: Dr. Jurytko: „Es wird keinen Langstreckenfernverkehr ohne Wasserstoff geben.“
Ungefähr zur gleichen Zeit könnte grauer Wasserstoff aufgrund steigender CO2-Preise genauso teuer sein wie grüner Wasserstoff, antizipierte Gilles Le Van von Air Liquide.
Lebhafter Austausch in den Foren
Darüber hinaus erläuterten im Public Forum der Hydrogen + Fuel Cells Europe (s. Abb. 3 u. 4) Aussteller auch in diesem Jahr wieder ihre Neuentwicklungen oder diskutierten mit Gästen aus Industrie und Politik. Etwa darüber, welche Rahmenbedingungen bzw. Anreize hinsichtlich Sektorenkopplung und Flexibilisierung des Energieverbrauchs noch fehlen oder wo und wie man grünen Wasserstoff weltweit in ausreichend großen Mengen erzeugen wird.
Auch die Frage, wie viel Wasserstoff Deutschland selbst produzieren und wie viel von europäischen Nachbarn importiert werden wird, erörterte Moderator Ulrich Walter mit verschiedenen Gästen. Christian Maaß, Leiter der Abteilung Energiepolitik – Wärme und Effizienz im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK), berief sich bei seiner Antwort auf Schätzungen, wonach Deutschland knapp die Hälfte seines Bedarfs an klimaneutralem Wasserstoff selbst erzeugen könne, der Rest müsse dann importiert werden.
Auf Nachfrage des Moderators, warum die Elektrolysekapazitäten bis 2030 nicht gleich auf 20 GW hochgesetzt würden, antwortete Maaß: „Mit höheren Zielen wäre ich vorsichtig, da Elektrolyseure viel Strom brauchen.“ Deshalb plädiere er dafür, die Herstellung von grünem H2 am Ausbau der erneuerbaren Energie auszurichten. Nicht zuletzt um Zielkonflikte zu vermeiden, denn der direkte Verbrauch von Grünstrom solle ja Vorrang haben. Insofern gehe er davon aus, dass große Mengen an grünem Wasserstoff voraussichtlich aus Übersee importiert würden, in Form von Ammoniak, Methan und SAF. Insgesamt werde die Bundesrepublik jedoch rund zehn Prozent der weltweiten H2-Produktion benötigen, was sie zum Global Player mache.
Ganz anders sieht das Heinrich Gärtner, Gründer und CTO der GP Joule Gruppe. Er zeigte sich überzeugt, „dass wir viel mehr grünen Wasserstoff inländisch herstellen können, als wir heute denken“, und erläuterte: „Wir haben bereits ein großes Potenzial an erneuerbaren Energien, und dieses wächst weiter an. Damit nimmt auch die Menge an Überschussstrom zu, die man zur Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse nutzen kann.“ Das sei nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Das entlaste die Netze und ermögliche lokale Wertschöpfung. Seiner Ansicht nach braucht Deutschland nur einen winzigen Teil seiner Fläche, um den gesamten Bedarf an regenerativer Energie selbst herzustellen. „Wir haben alles hier: die Technik und die Infrastruktur.“
Abb. 4: Zahlreiche politische Vertreter*innen standen Rede und Antwort
Kooperation im europäischen Raum
Werner Diwald, Vorsitzender des Deutschen Wasserstoff-Verbands, sagte: „Die EU-Mitglieder sollten unsere Hauptimportländer sein, nicht zuletzt um die gegenseitigen Beziehungen zu stärken und die Stabilität innerhalb der Europäischen Union zu unterstützen.“ Er äußerte sich zudem optimistisch, dass es mit dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft schnell gehen könne, sowie es einen Markt und entsprechende Geschäftsmodelle gebe. Ähnliches habe man ja auch schon bei den erneuerbaren Energien gesehen. Man solle nicht vergessen: Die ganze Welt brauche grünen Wasserstoff. Deutschland habe deshalb große Konkurrenz, denn auch die anderen Länder machten sich mit ihren jeweils eigenen H2-Strategien auf den Weg, so Diwald.
Dass der anvisierte Transformationsprozess längst im Gange ist, bewiesen die anwesenden Politiker mit teils beeindruckenden Zahlen: So sprach Olaf Lies über 30 Großgaskraftwerke in Niedersachsen, die H2-ready gemacht werden sollen. Und seine Kollegin Mona Neubaur, Wirtschaftsministerin aus Nordrhein-Westfalen, kündigte 200 Wasserstofftankstellen bis 2030 an. „Wir setzen die Infrastruktur passgenau in die Region.“ Sie beteuerte, NRW solle die erste CO2-neutrale Industrieregion werden.
Hermes Startup Award: And the winner is …
Wie jedes Jahr prämierte die Messe ein besonders innovatives Unternehmen, das nicht älter als fünf Jahre ist. Für 2024 ging der Hermes Startup Award an Archigas aus Rüsselsheim. Das Unternehmen erhielt den Award für einen feuchtigkeitsresistenten Sensor zur Messung von Wasserstoff. Das Prinzip, das gemeinsam mit der Hochschule RheinMain entwickelt wurde, basiert nach Angaben des Herstellers auf einer verbesserten Messung der Wärmeleitfähigkeit auf einem Mikrochip. Die innovative Technologie zeichne sich durch „Miniaturisierung, robustes Design, kurze Messzeiten und vielfältige Einsatzmöglichkeiten“ aus, lobte Prof. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und Vorsitzender der Jury des Hermes Startup Awards. Archigas sei ein „exzellentes Beispiel für innovationsgetriebene Unternehmen“, welche die Grundlage schafften, um die Wasserstoffwirtschaft zu verwirklichen.
Norwegen als Pionier für grüne Industrietransformation
Das Partnerland Norwegen war mit einem eigenen Pavillon zu den Themenbereichen Energie, Prozessindustrie, Batterie- und Ladelösungen sowie Digitalisierung in Halle 12 und auch auf dem orangefarbenen Teppich der H2-Messe vertreten – mit dem Slogan „Pioneering the Green Industrial Transition“. Als Energieproduzent und Vorreiter in Sachen E-Mobilität sieht sich das skandinavische Land als eine Art Katalysator, um den grünen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft zu beschleunigen. Etwa bei der Entwicklung im Bereich regenerativer Energien und dem Einsatz digitaler Lösungen, um die Industrie auf Netto-Null zu trimmen, wie der H2-Experte und ehemalige LBST-Mitarbeiter Ulrich Bünger erläuterte, der im „Ruhestand“ Norwegian Energy Partners (Norwep) berät. Ziel sei, ab 2030 etwa vier Prozent des europäischen Importbedarfs von schätzungsweise zehn Millionen Tonnen Wasserstoff selbst zu produzieren.
„Norwegen und Deutschland sind wichtige Handelspartner, und wir sind eine strategische Industriepartnerschaft für erneuerbare Energien und grüne Industrie eingegangen“, sagte der norwegische Handels- und Industrieminister Jan Christian Vestre zur Eröffnung der Messe. „Wir hoffen, dass die norwegische Präsenz auf der Hannover Messe diese enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern weiter stärken wird.“
Abb. 5: Honda zeigte sein neues BZ-System
Durch das EWR-Abkommen sei Norwegen vollständig in den europäischen Binnenmarkt integriert, so dass Handel und Investitionen nahtlos zwischen Norwegen, Deutschland und den anderen Ländern der Europäischen Union flössen. Während der Messe schloss die Bundesrepublik mit dem skandinavischen Partner außerdem ein Abkommen zur Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage, CCS).
Einen Großauftrag konnte der norwegische Hersteller von Wasserstoffspeichersystemen, Hexagon Purus, verkünden. Ab dem zweiten Quartal 2024 wird er H2-Tanks an das Berliner Unternehmen Home Power Solutions (HPS) liefern, das nach eigenen Angaben den weltweit ersten Ganzjahres-Stromspeicher für Gebäude entwickelt hat. Das Picea-System wird vorrangig in Einfamilienhäusern in Kombination mit PV-Modulen eingesetzt. Überschüssiger Solarstrom, der vor allem im Sommer anfällt, wird mithilfe eines Elektrolyseurs in grünen Wasserstoff umgewandelt, der in Hochdrucktanks von Hexagon gespeichert wird. Im Winter dient dieser dann zur Rückverstromung. Auf diese Weise lassen sich Gebäude nach Angaben von HPS ganzjährig mit Sonnenenergie versorgen. „Unsere Hochdruck-Wasserstofftanks sind flexibel und skalierbar, deshalb eignen sie sich für ein breite Palette von Anwendungen“, etwa solche wie bei HPS, sagte Matthias Kötter, Geschäftsführer des Standorts in Weeze.
Kreativität und Erfindergeist in Halle 13
Eine Produktinnovation präsentierte zum Beispiel SFC Energy mit dem EFOY H2PowerPack X50, einer Pilotreihe für das bisher leistungsstärkste Brennstoffzellensystem mit bis zu 200 kW im Clusterbetrieb. Diese jüngste Entwicklung bietet dem Nutzer nach Angaben des BZ-Spezialisten aus Bayern eine kontinuierliche elektrische Ausgangsleistung von 50 kW. Es können jedoch bis zu vier dieser H2PowerPacks zusammengeschlossen werden, um eine Leistung von 200 kW zu erreichen. Ausgestattet ist die umwelt- und klimafreundliche Alternative zu Dieselgeneratoren mit Standard-400-V-AC-Anschlüssen, einer integrierten Lithium-Batterie sowie einer 300-bar-Wasserstoffschnittstelle.
Der Betrieb ist nach Herstellerangaben emissionsfrei, es werden weder CO2, Kohlenmonoxid, Stickoxide noch Feinpartikel ausgestoßen. Als Einsatzgebiet kommen beispielsweise die Notstromversorgung von Krankenhäusern oder Kommunikations- bzw. IT-Anlagen, die mobile Stromversorgung von Baustellen und Veranstaltungen oder eine kontinuierliche Stromversorgung von autarken Unternehmen infrage. „Mit dem Vorstoß in höhere Leistungsklassen reagiert SFC Energy auf eine entsprechend hohe Marktnachfrage“, teilte das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz Brunnthal bei München mit. Die Serienherstellung und Markteinführung sind für Anfang 2025 geplant.
Abb. 6: Der diesjährige H2 Eco Award ging an den Energiepark Bad Lauchstädt
Lhyfe baut aus
Wie der Wasserstoffhochlauf aus Sicht des mittlerweile in elf europäischen Ländern operierenden Lhyfe-Konzerns aussieht, berichtete Luc Graré, der den Geschäftsbereich für Mittel- und Osteuropa leitet: „Wir skalieren gerade unsere Produktion hoch.“ Die Philosophie des 2017 gegründeten Wasserstoffpioniers beschreibt er folgendermaßen: „Wir starten klein, lernen, wachsen, lernen wieder, wachsen weiter und skalieren dann auf.“ Nachdem das Unternehmen in Frankreich mit einer Elektrolysekapazität von einem Megawatt begonnen habe, liege die nun bei 10 MW.
Zurzeit sind sechs Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff geplant bzw. im Bau: Drei in Frankreich, drei in Deutschland. „Und es werden immer mehr.“ Eine 10-MW-Anlage befindet sich in der niedersächsischen Hafenstadt Brake (Unterweser) im Bau. Dort sollen jährlich bis zu 1.150 Tonnen an grünem H2 erzeugt werden, das an regionale Kunden aus dem Industrie- und Mobilitätssektor geht. Den Bezug von Grünstrom hat sich das Unternehmen durch langfristige Stromverträge (PPA) mit Betreibern von Windparks und Photovoltaikanlagen gesichert.
Eine weitere 10-MW-Anlage ist seit Herbst 2023 in Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, im Bau und soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Betrieb gehen – mit einer Produktion von bis zu vier Tonnen grünem Wasserstoff pro Tag. Noch in der Entwicklung ist der Plan, bis 2029 eine 800-MW-Anlage im vorpommerschen Lubmin in Betrieb zu nehmen, die auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks errichtet werden soll. Der künftig dort erzeugte Wasserstoff könnte nach Angaben von Lhyfe in das entstehende Wasserstoffnetz eingespeist werden.
Ameisensäure als H2-Speicher
Auch außerhalb der Halle 13 ging es viel um Wasserstoff. An manchen Ständen sah es aus wie in einem Chemielabor, mit blubberndem Wasser in Glasgefäßen oder einer trüben Nährflüssigkeit in transparenten Bioreaktoren. Damit zeigte Festo in Halle 7 seine neueste Errungenschaft in Sachen H2-Speicherung: die sogenannte BionicHydrogenBattery (s. Abb. 7). Darin enthalten sind Bakterien aus dem zentralafrikanischen Kivusee, die in einem natürlichen Prozess Wasserstoff in Ameisensäure umwandeln. In dieser chemisch gebundenen Form lässt sich Wasserstoff vergleichsweise einfach speichern und transportieren. Und auch klimafreundlicher, denn ein energieintensives Komprimieren entfällt ebenso wie das Kühlen auf -253 °C, um Wasserstoff zu verflüssigen. Die Bedingungen, unter denen die Mikroorganismen ihren Dienst tun, sind moderat: Sie brauchen eine Temperatur von 65 °C und einen Druck von 1,5 bar.
Abb. 7: Der Kultivierungsreaktor der BionicHydrogenBattery von Festo
Normalerweise leben die Bakterien namens Thermoanaerobacter kivui im Schlamm unter Sauerstoffabschluss (anaerob). Sie besitzen ein Enzym, mit dem sie Wasserstoff und Kohlendioxid in Ameisensäure (CH2O2) umwandeln können. Zudem können sie den Prozess auch umkehren. Die Grundlagenforschung auf diesem Gebiet leistete das Team um Volker Müller, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt und Leiter der Abteilung Molekulare Mikrobiologie und Bioenergetik, mit dem das Bionic-Projektteam von Festo nach eigenen Angaben eng zusammenarbeitet.
Das Spannende an diesem biologischen Prozess sei aus ökonomischer Sicht nicht nur die Geschwindigkeit der Reaktion, sondern auch, dass die Bakterien als Katalysatoren fungieren: „Sie werden nicht verbraucht“, erklärt das auf Automatisierungstechnik spezialisierte und weltweit tätige Unternehmen, das 1925 in Esslingen gegründet wurde. „Der Prozess lässt sich mit genügend Regenerationsphasen beliebig wiederholen – ganz im Sinne eines Kreislaufs.“ Da die Reaktion in beide Richtungen ablaufen kann, sind Bakterien dieser Art in der Lage, Ameisensäure am Zielort wieder in Wasserstoff und Kohlendioxid zu zerlegen. CO2 kann dann zum Beispiel in der Getränkeindustrie eingesetzt werden.
Positives Fazit
Auf der Abschluss-Pressekonferenz zog Jochen Köckler erwartungsgemäß eine positive Bilanz: Mehr als 130.000 Besucher aus über 150 Ländern trafen auf 4.000 Aussteller aus 60 Ländern. 40 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland: die meisten aus China und den benachbarten Niederlanden, dann folgten die USA, Korea und Japan. Gunnhild Brumm von der norwegischen Wirtschaftsförderungsorganisation Innovation Norway freute sich über gute Geschäfte und Vertragsabschlüsse: „Kurz gesagt: Es hat sich super gelohnt! Es war ein richtiger Boost für uns. Wir kommen gerne wieder.“ Natürlich nicht noch mal als Partnerland, denn das ist im nächsten Jahr Kanada.
„Wir legen den Grundstein für die H2-Wirtschaft der Zukunft. […] Bei künstlicher Intelligenz (KI) ist die Geschwindigkeit an einigen Stellen zu hoch, bei Wasserstoff brauchen wir unbedingt mehr Tempo.“
Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender Deutsche Messe
Autoren: Monika Rößiger & Sven Geitmann



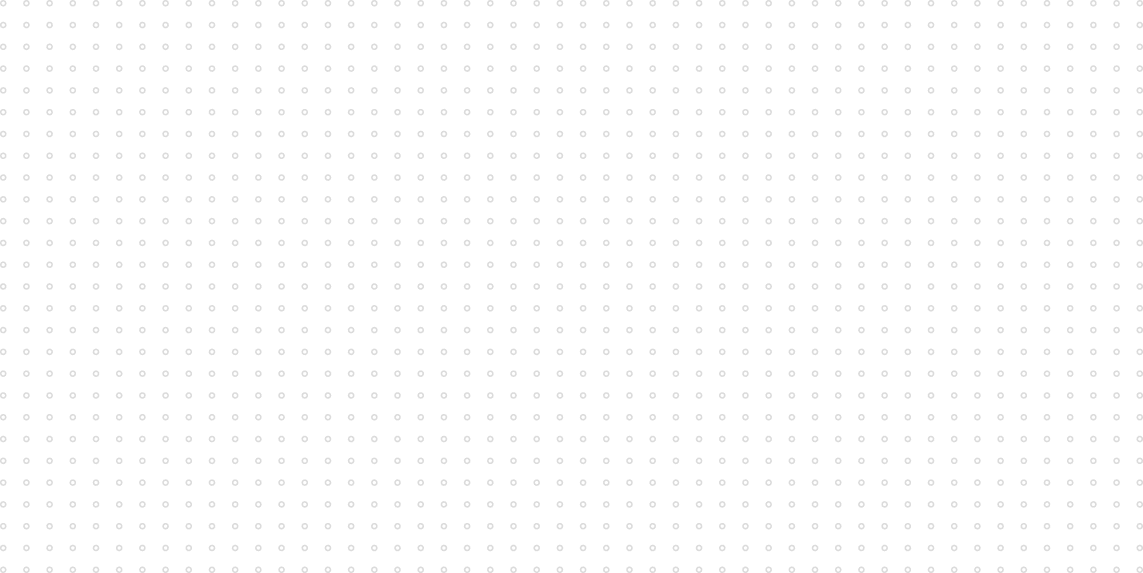








0 Kommentare